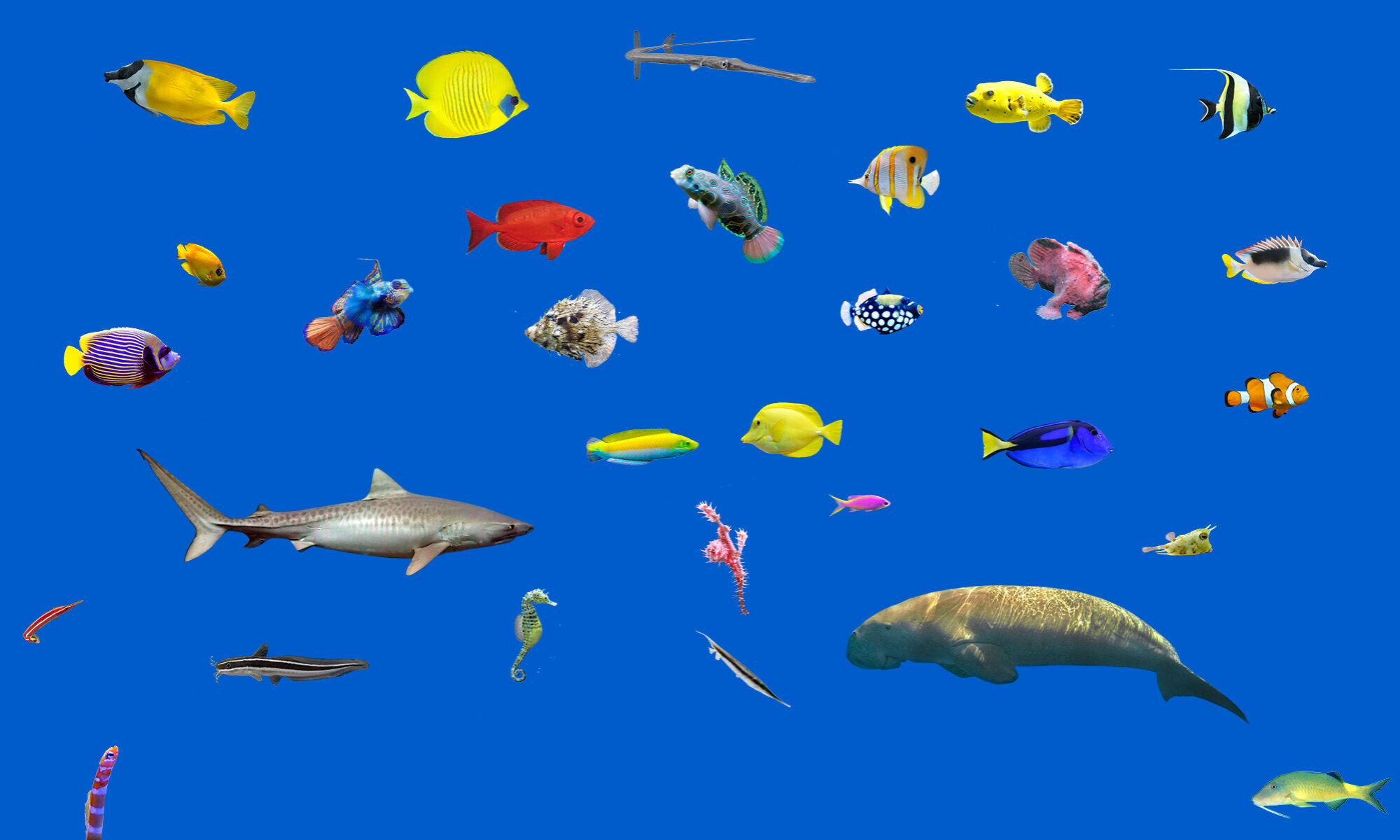Pottwal
Sperm whale
Physeter macrocephalus

Größe: bis 18 m, große Bullen vielleicht sogar bis 25 m
Lebensraum: sowohl polare als auch tropische Bereiche aller Ozeane; bevorzugt aber die tropischen und subtropischen Zonen
Vorkommen: Malediven, Südjapan, Vietnam, ganz Südostasien, Nordaustralien
Erkennungsmerkmale: Grundfarbe grau, einzigartige, fast rechteckige Kopfform; an der Unterseite ein schmaler, sehr langer Unterkiefer
Biologie & Verhalten: Wer ist das außergewöhnlichste Lebewesen der Meere? Unter den Kandidaten befindet sich auf jeden Fall der Pottwal. Das fängt schon mit seinem englischen Namen an: „Sperm whale“. „Sperm“ bedeutet übersetzt Sperma und beruht auf einen Irrtum. Bis in das 19. Jahrhundert hinein glaubte man allen ernstes, dass das weißliche, als Schmierstoff geeignete Walrat das Sperma des Pottwales sei. Dabei störte niemanden, dass sich dieses im Kopf befand und dass es tonnenweise vorhanden war.
Und noch etwas befindet sich im Kopf des Pottwales: Das mit bis zu ca. 8 kg größte Gehirn im ganzen Tierreich. Wie intelligent es ihn wirklich macht, wissen wir nicht. Glaubwürdig ist aber die Geschichte des Augenzeugen Owen Chase über den Untergang des Walfängers Essex im Jahre 1820. Das Schiff wurde von einem Pottwalbullen angegriffen. Er rammte das Schiff mehrmals bis es sank. Das wirklich interessante dabei ist, dass er nicht die kleinen Walfangboote angriff, die die Wale harpunierten, sondern das Zentrum der Bedrohung: Das Mutterschiff. Er konnte also die Lage wahrnehmen und interpretieren. Später setzte Herman Melville diesem Wal mit dem Roman „Moby Dick“ ein literarisches Denkmal.
Übrigens orientieren sich Pottwale, genau wie Delfine mit Hilfe von Echoortung. Damit können sie alles finden, was in der Reichweite des Biosonars liegt, egal wie trübe das Wasser und wie dunkel die Tiefsee auch sein möge. Eine der Vorraussetzungen für extrem tiefes tauchen. Pottwale ortete man schon in 2500m Tiefe. Was er also mit ein paar Flossenschlägen erledigt, können wir Menschen nur, wenn wir auf 100 Jahre Ingenieurskunst zurückgreifen.
In diesen dunklen, kalten Tiefen geht er auf die Jagd nach Tintenfischen und dem legendären Riesenkalmar. Dieser wird inklusive seiner Arme bis zu 13 m lang und ist sicher keine leichte Beute. Wie er es schafft, dieses Ungeheuer zu besiegen und zu fressen bleibt bis heute eines der großen Geheimnisse der Tiefsee. Nur die Narben auf der Haut des Wales zeugen von diesen Kämpfen. Sicher ist nur eines: Wenn er es geschafft hat, dann tritt der Kalmar eine ungewöhnlich lange Reise an. Sie beginnt in den vier Mägen des Pottwales. Der erste ist eine Art Muskelpresse, die die eventuell noch lebenden Kalmare zerquetscht. Erst in den folgenden Mägen verrichtet die Magensäure ihr Werk. Danach folgt ein kurvenreicher Weg von ca. 300 m, bis sie als Kothaufen ausgeschieden werden. Damit besitzt der Pottwal den längsten Darm aller Tiere. Zum Vergleich: Bei uns Menschen hat ein verdauter Burger gerade mal eine Reise von 8 m hinter sich.
Dieser Verdauungsapparat ist noch zu einer weiteren Höchstleistung fähig. Er produziert den begehrtesten Rohstoff für die Herstellung von Parfum: Ambra. Frisches Ambra riecht und sieht genau so aus, wie wir es uns auf Grund seiner Herkunft vorstellen. Einmal durch den After oder das Maul ausgeschieden und jahrelang im Meerwasser treibend, verwandelt es sich aber in einen wohlriechenden, dunkelgrauen Klumpen, der sich hervorragend als Geruchsspeicher eignet. Ambra wird heute von synthetischen Stoffen ersetzt. Lediglich für die ganz teuren Parfums wird es nach wie vor eingesetzt. Wer also auf dem Meer einen Ambrahaufen findet, kann sich glücklich schätzen. Für ein Kilo werden ca. 30.000 Euro bezahlt. Schon vor über 150 Jahren machte man sich über diese Tatsache lustig. Herman Melville: „Wer würde wohl denken, dass die feinsten Damen und Herren sich an einem Wohlgeruch laben, den man aus den ruhmlosen Gedärmen eines kranken Pottwals holt!„ Ob das Entstehen von Ambra allerdings wirklich auf eine Krankheit in Form von Verdauungsproblemen des Pottwales zurückgeht, oder lediglich ein Schutzmechanismus ist, um die unverdaulichen Hornkiefer der Tintenfische einzuschließen, konnte bis heute nicht geklärt werden.
Ein weiteres Rätsel stellen die Zähne des Pottwales dar. Verwendbare Zähne befinden sich nur im Unterkiefer, während sie sich im Oberkiefer lebenslang unter dem Zahnfleisch verstecken. Die Zähne des Unterkiefers werden allerdings bis zu 20 cm lang und waren, ähnlich wie Stoßzähne bei Elefanten, beliebte Jagdsouvenirs. Oft wurden sie durch Schnitzereien verziert, gerne auch mit erotischen und derben Darstellungen nackter Frauen. Den einzigen Spaß den Walfänger auf ihren monatelangen Fahrten so hatten. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich bei den Zähnen um eine Art evolutionäres Überbleibsel handelt, das nicht mehr gebraucht und nach und nach verschwindet. Rudimentäre Organe, Körperteile oder Verhalten ist in der Biologie nichts besonderes. Auch wir Menschen besitzen sie. Beispiele sind die Weisheitszähne oder der Blinddarm.
Weibliche Pottwale schließen sich zu Gruppen zusammen, um den Gebärenden und den Jungen Schutz zu bieten. Diese werden nach 14-16 Monaten Tragzeit lebend geboren. Nach heutigen Erkenntnissen werden Pottwale über 70 Jahre alt.
Bedrohungsstatus: Die Art wird auf der Roten Liste der IUCN als „gefährdet“ geführt.